
MARIO BAVA - IL MAESTRO DELL'ORRORE
|
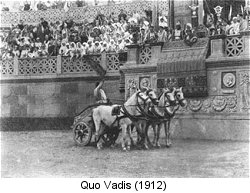 |
 |
 |
Nach Benito Mussolinis Machtergreifung im Jahre
1922 dauerte es nicht lange, bis der Faschismus sich des Mediums Film
als bevorzugtes Propagandamittel bediente. 1926 wurde Eugenio Bava in
Rom vom Istituto LUCE als Leiter der Abteilung für optische Effekte
engagiert. Das Istituto LUCE (= L'Unione Cinematografica Educativa)
war ursprünglich von verschiedenen privaten Gruppen gegründet
worden, um didaktische Filme zu produzieren. Unter Mussolini wurde es
1925 jedoch zu einer staatlichen Institution, die zur Verbreitung von
"Volkskultur und Bildung" beitragen sollte und neben Dokumentar-
und Lehrfilmen nun auch verstärkt propagandistische Wochenschauen
(cinegiornali) produzierte, die ab 1926 in allen italienischen
Kinos gezeigt werden mußten. Daß Eugenio Bava hier mit großer
ideologischer Begeisterung bei der Sache war, ist zu bezweifeln. Wahrscheinlicher
ist, daß er diesen Posten aufgrund des gesicherten regelmäßigen
Einkommens annahm (immerhin hatte er eine Familie zu ernähren)
und nicht zuletzt auch die Möglichkeiten schätzte, die sich
ihm hier zur Weiterentwicklung seiner eigenen Arbeit boten.
Mario Bava wuchs quasi umgeben von den Ingredienzen des Kinos auf, und
an die mit Skulpturen, Miniaturmodellen und Filmchemikalien angefüllte
Werkstatt seines Vaters erinnerte er sich später als "ein
Wunderland". Solchermaßen familiär vorbelastet faßte
er schnell den Wunsch sich ebenfalls den schönen Künsten zu
widmen. Zunächst schlug sein Herz für die Malerei und er begann
in Rom Kunst zu studieren. Als dieses Vorhaben jedoch - aus finanzieller
Not einerseits, aus Schwierigkeiten Bavas mit dem Universitätssystem
im faschistischen Italien andererseits - scheiterte, begann er seinem
Vater bei dessen Arbeit am Istituto LUCE zu assistieren. Von ihm erlernte
er den Umgang mit der Filmkamera und die Geheimnisse der filmischen
Illusionen, der Magie von Licht und Schatten. Zum Ende der 30er Jahre
konnte er sich schließlich selbst als Kameramann etablieren und
bereits in den späten 40er Jahren drehte er eine Serie eigener
kurzer Kunstdokumentationen.
Auch wenn er den Pinsel nun mit der Kamera vertauscht hatte, sah Bava seine Arbeit
immer noch mit den Augen eines Malers und war sich der enormen Bedeutung, die
sorgfältige Bildkompositionen für das Filmemachen haben, immer bewußt.
Ebenso wie sein Vater war auch er ein künstlerisches Multitalent: Seine innovativen
Ausleuchtungsideen und sein enormer Einfallsreichtum, der es ihm ermöglichte,
schier aus dem Nichts und mit einem Minimum an zeitlichem Aufwand verblüffend
realistisch wirkende Spezialeffekte zu erschaffen, verhalfen ihm im Verlauf der
50er Jahre zu einem exzellenten Ruf. So war er z. B.: als Chefkameramann in sieben
frühen Filmen mit Gina Lollobrigida nicht unmaßgeblich für den
Erfolg der Schauspielerin mitverantwortlich, die zu einem der größten
italienischen Filmstars der 50er und 60er Jahre werden solte. In den Studios von
Cinecittà galt er bald als einer der besten Kameramänner und Filmtechniker
und arbeitete u. a. für Regisseure wie Roberto Rossellini (u. a. bei La
nave bianca, 1942), Vittorio De Sica (Villa Borghese, 1953), Georg
Wilhelm Pabst (Cose da pazzi, 1953), Robert Z. Leonard (La donna più
bella del mondo, 1955) und Raoul Walsh (Esther e il Re, 1960). "Ich
lernte von jedem von ihnen etwas", erzählte Bava in einem Interview.
"Ich lernte, was man tun und - noch viel wichtiger - was man nicht tun
sollte."
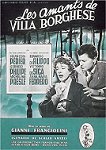 |
 |
 |
 |
 |
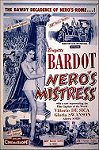 |
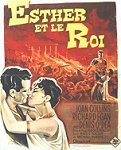 |
Zwar hatte Bava bereits 1955 (ohne dafür in den Credits Erwähnung
zu finden) einige Sequenzen in Mario Camerinis Ulisse inszeniert,
dachte zu dieser Zeit jedoch keineswegs an eine Karriere als Regisseur
und hatte in dieser Hinsicht auch keinerlei Ambitionen. Daß er
sich dennoch eines Tages - wenn auch auf Umwegen - im Regiestuhl wiederfand,
verdankte er nicht zuletzt seiner Freundschaft zu dem Regisseur Riccardo
Freda, der nach dem Krieg eine Reihe recht erfolgreicher Historien-
und Kostümfilme gedreht hatte und in den kommenden Jahren zu einem
der wichtigsten italienischen Genreregisseure werden sollte. 1956 wurde
Bava als Kameramann und Effektdesigner für dessen Film I Vampiri,
einem Projekt der Produktionsfirma Galatea, engagiert. Freda hatte zugesagt
den Film innerhalb von zwölf Tagen fertigzustellen, merkte jedoch
bald, daß er diesen Zeitplan nicht einhalten konnte. Als ihm keine
Verlängerung der Drehzeit gewährt wurde, überwarf er
sich mit den Produzenten, verschwand nach zehn Tagen auf Nimmerwiedersehen
vom Set und hinterließ einen halbfertigen Film. So kam es, daß
Bava sich - von der Situation völlig überrumpelt - plötzlich
selbst in der Rolle des Regisseurs wiederfand und den Rest des Films
innerhalb von nur zwei Tagen beendete.
I Vampiri, eine atmosphärische Melange aus Elementen des Kriminalfilms,
Gothic Horror-Stilmitteln und klassischen Mad Scientist-Klischees,
wird heutzutage oft als der erste "richtige" italienische
Horrorfilm bezeichnet, was jedoch nur bedingt zutrifft: Bereits in der
Stummfilmzeit gab es einige italienische Produktionen, die sich der
Materie annahmen, so z. B. Nino Oxilias Faust-Variation Rapsodia
Satanica (1917) oder Eugenio Testas Il mostro di Frankenstein
(1920). In der Ära Mussolini waren solche Filme, die oftmals "subsersive"
oder "amoralische" Themen aufwiesen, jedoch nicht sonderlich
beliebt. Zwar war die Zensur in Italien - anders als in Nazideutschland,
wo innerhalb kurzer Zeit eine blühende Filmkultur zerschlagen und
glechgeschaltet wurde - zum Verdruß des Regimes bis in die Anfänge
des 2. Weltkriegs hinein eher halbherzig gehandhabt worden, der Phantastische
Film war dennoch kaum existent (als wichtige Ausnahmeerscheinung wäre
hier Mario Soldatis gotisches Melodram Malombra zu nennen). Für
das italienische Nachkriegskino waren zunächst eher Komödien,
Kostümfilme und - für eine kurze Zeit - neorealistische Filme
von Bedeutung; der Bedarf an Horror hielt sich in diesen Jahren verständlicherweise
in Grenzen. Erst mit I Vampiri begann das Genre in Italien wieder
Fuß zu fassen und der Film markiert den Beginn einer höchst
fruchtbaren Ära, die bis in die 70er Jahre hinein einen nicht gerade
unbeträchtlichen Anteil der italienischen Filmproduktionen ausmachen
sollte. Zugleich kann I Vampiri zu 50% auch als eigentliches
- wenngleich inoffizielles - Regiedebüt Mario Bavas betrachtet
werden und trägt schon unverkennbar dessen stilistische Handschrift.
Als I Vampiri in die italienischen Kinos kam, hielt sich der
Erfolg allerdings in Grenzen. Das Horrorgenre wurde damals von angloamerikanischen
Produktionen dominiert und der Großteil des italienischen Publikums
stand einheimischen Filmen mehr als skeptisch gegenüber. So beschloß
Riccardo Freda seine kommenden Horrorfilme unter dem englischen Pseudonym
"Robert Hampton" zu drehen; ein Trick der später auch
von anderen Regisseuren in Italien aufgegriffen wurde (so agierte z.
B. Antonio Margheriti bis in die 80er Jahre hinein als "Anthony
Dawson").
Daß Mario Bava die Produktion von I Vampiri quasi gerettet
hatte, brachte ihm offiziell keine Anerkennung. Statt dessen schien
es in den folgenden Jahren allmählich zu einer Gewohnheit zu werden,
ihn als inoffiziellen Co-Regisseur einzusetzen: So drehte er Teile von
Pietro Francisis Peplum-Epen La Fatiche di Ercole und Ercole
e la regina di Lidia, ohne dafür ein höheres Honorar zu
erhalten oder in den Credits Erwähnung zu finden. In seiner 1981
erschienenen Autobiographie Divoratori di celluloide erinnerte
sich Riccardo Freda in diesem Zusammenhang: "Andere Regisseure
riefen ihn und Mario löste jegliches Problem für sie... Dann
erzählte er mir, daß man ihn bei der Filmpremiere immer in
der hintersten Sitzreihe versteckte, damit all der Ruhm auch nur dem
Regisseur zukam. Ich erinnere mich, daß er in dem Zusammenhang
einmal einen Film Francisis erwähnte, dessen Erfolg zu mindestens
70% sein Verdienst war. Er war von der Art wie er behandelt wurde entäuscht
und so sagte ich ihm: 'Entweder du hörst auf, für diese schlechten
Regisseuren zu arbeiten, oder ich mache meine nächsten Filme ohne
dich.' Er hörte mir - wie üblich - leicht spöttisch lächelnd
zu, doch er beherzigte meinen Ratschlag. Als Francisi ihn später
für Archimede heuern wollte, lehnte Mario ab und natürlich
wurde der Film ein furchtbares Desaster."
 |
 |
 |
 |
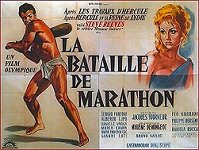 |
1959 kam es bei dem Horrorfilm Caltiki - Il mostro immortale
erneut zu einer Zusammenarbeit zwischen Bava und Freda, der hier erstmals
als "Robert Hampton" firmierte (Bava selbst wird in den Credits
unter den englischen Pseudonymen "John Foam" und "Marie
Foam" gelistet; "Foam" [= Schaum] ist die englische Entsprechung
seines Namens). Nach nur zwei Drehtagen zerstritt Freda sich auch hier
wieder mit den Produzenten, brach seine Arbeit ab und überließ
Bava die Fertigstellung des Films - diesmal immerhin runde 70%!
Caltiki, in dessen Mittelpunkt eine alles verschlingende amorphe
Masse gleichen Namens steht, ist - ebenso wie Irvin Yeaworths im Jahr
zuvor entstandenes B-Movie The Blob - ein recht gelungener Rip
Off der erfolgreichen Hammerproduktionen The Quatermass Xperiment
(GB 1955, Regie: Val Guest) und X - The Unknown (GB 1956, Regie:
Leslie Norman). Mario Bava realisierte hier mit einfachsten Mitteln
und einem absolut lächerlichen Budget einige beeindruckende Spezialeffekte,
so bestand z. B. das titelgebende Monster aus einem Haufen von Tierinnereien,
der mit Hilfe von Stromstößen "belebt" wurde und
so zuckend in die Miniaturmodelle eindringen konnte. Für eine Szene
wurde auch ein lebensgroßes Eingeweidemonster angefertigt, das
von einem darunter hockenden Mitarbeiter der Drehcrew bewegt wurde -
ein wirklich bemitleidenswerter Mensch, denn der Film wurde im Hochsommer
gedreht und die Innereien waren alles andere als frisch.
In einem späten Interview erzählte Riccardo Freda übrigens,
daß er von vornherein den Abbruch der Dreharbeiten geplant hatte,
um seinem Freund Bava auf Umwegen endlich zu einer Anerkennung als Regisseur
zu verhelfen. Ob Freda tatsächlich nur aus diesem selbstlosen Motiv
handelte sei dahingestellt - es ist jedoch anzunehmen, daß SciFi-Horror
a la Caltiki den Regisseur herzlich wenig interessierte und es
ihn zugleich auch ärgerte, wie der ambitionslose Bava sich von
den Produzenten ausnutzen ließ.
Auch bei Caltiki - il mostro immortale wurde Bavas Regiearbeit
nicht erwähnt, nachdem er im gleichen Jahr aber auch noch für
Jacques Tourneur bei dem Historienspektakel La battaglia di Maratona
einspringen mußte, gab Galatea Film (personifiziert in dem Produzenten
Lionello Santi) ihm endlich die Chance zu einem eigenen Regiedebüt
seiner Wahl - vorausgesetzt, daß dieses nicht zu viel Geld kosten
würde.
Der inzwischen 46jährige Bava stand dieser neuen Karriere zunächst
sehr skeptisch gegenüber. "Ich wollte kein Regisseur sein",
erinnerte er sich später. "Meiner Meinung nach muß
ein Regisseur ein wirkliches Genie sein. Außerdem habe ich mich
als Kameramann wohlgefühlt und gutes Geld verdient."
Nach gründlichen Überlegungen entschied Bava sich schließlich
dafür, einen Horrorfilm zu drehen. Schon immer von den Klassikern
der russischen Literatur fasziniert, wählte er als Basis für
das Drehbuch Nikolai Gogols phantastische Erzählung Der Wij.
Das endgültige Skript hatte mit der literarischen Vorlage zwar
nur noch entfernt etwas zu tun, doch der daraus resultierende Film sollte
einer der schönsten Horrorklassiker in der Geschichte des Kinos
werden.
So entstand 1960 seine erste "offizielle" Regiearbeit La
maschera del demonio (der Titel war eine Anspielung auf die Hammerproduktion
The Curse of Frankenstein, die in Italien zuvor als La maschera
di Frankenstein die Kinokassen gefüllt hatte): Im Mittelpunkt
des Films steht die schöne vampirische Hexe Asa, die im 17. Jahrhundert
grausam hingerichtet wird und zwei Jahrhunderte später wieder zum
Leben erwacht, um Rache an ihren Nachfahren zu nehmen. Der in Schwarzweiß
gedrehte La maschera... zeichnet sich durch eine geradezu (alp-)traumhaft
schöne Atmosphäre und eine immens beeindruckende visuelle
Kraft aus, die sich in nur wenigen Filmen finden läßt. In
einem unnachahmlichen visuellen Stil vermengte Bava in seinem Debüt
stilistische Elemente des expressionistischen Stummfilms und der britischen
Hammer Productions mit einer schon fast barocken, sinnlichen Bildsprache.
Die charismatische Präsenz der geradezu mesmerisierend in Szene
gesetzten jungen Hauptdarstellerin Barbara Steele tat ein übriges,
um La maschera... zu einem unvergeßlichen Erlebnis zu machen.
Der Film konnte in Italien und auch international große Erfolge
verbuchen, und fand - selten für eine Genreproduktion - sogar Anerkennung
in der "seriösen" Filmkritik. 1961 erwarb die amerikanische
Produktionsfirma AIP für 100.000 $ die Verleihrechte für das
englischsprachige Ausland, wodurch für Galatea Film mit einem Schlag
die Produktionskosten ausgeglichen wurden. Dies markierte zugleich den
Beginn der Zusammenarbeit zwischen Bava und der AIP, die in den kommenden
Jahren seine Filme recht erfolgreich in den USA vermarkten sollte. Zugleich
war La maschera... auch der Auslöser einer Welle von Gothic
Horror-Produktionen, die das italienische Genrekino der 60er Jahre
prägten und wurde für Barbara Steele zum Beginn ihrer (eigentlich
ungewollten) Karriere als Diva des Horror all'italiana.
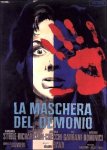 |
 |
 |
 |
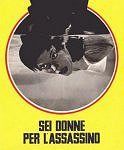 |
 |
 |
Unmittelbar nach seinem Regiedebüt stürzte
Mario Bava sich zunächst erst wieder in die Arbeit als Kameramann
und arbeitete für Raoul Walsh an dem Monumentalfilm Esther e
il Re mit, bei dem er in einigen Szenen auch Regie führte.
1961 inszenierte er als Co-Regisseur von Henry Levin ca. 20% des Fantasymärchens
Le meraviglie di Aladino und drehte im Anschluß - wieder
einmal "inoffiziell" - Teile von Giacomo Gentilomos Abenteuerfilm
L'ultimo dei Vikinghi. Im gleichen Jahr folgte auch Bavas zweite
eigene Regiearbeit Ercole al centro della terra. Hier hatte Bava
erstmals die Gelegenheit, in einem eigenen Projekt mit Farbfilm zu arbeiten
und so verwandelte er billige Pappkulissen in märchenhaft technicolorbunte
Mythenlandschaften, in denen der muskelbepackte Titelheld Hercules sich
gegen den finsteren König Lykus (dargestellt von Christopher Lee),
dessen untote Schergen und diverse Schattenwesen behaupten muß.
In den folgenden Jahren drehte Bava gotischen Horror, Thriller, Western,
Historienspektakel, einen Science Fiction-Film und sogar eine Erotikkomödie
- insgesamt mehr als 20 Filme zzgl. einiger Arbeiten für das italienische
Fernsehen. Unabhängig vom filmischen Umfeld war Bava immer besessen
vom sprichwörtlichen "Schein der Dinge" und von den verborgenen,
tiefschwarzen Schattenseiten des Menschen. Atmosphärische Stimmungsmalereien
und subtile, geradewegs ins Unterbewußte zielende optische Spielereien,
zwischen denen sich das Schicksal der oft von unseligen Obsessionen
und dunklen Leidenschaften zerrissenen Protagonisten erfüllte,
besaßen für ihn immer Vorrang vor einer geradlinigen Erzählweise,
wie sie z. B. dem angloamerikanischen Kino eigen war. Bava - der sich
selbst einmal augenzwinkernd als "romantischen Handwerker"
bezeichnete - war ein Allroundtalent: Von raffinierten Ausleuchtungstricks,
Kameraführung, Regiearbeit bis hin zum endgültigen Schnitt
des Films beherrschte er nahezu den kompletten filmtechnischen Arbeitsbereich
und betätigte sich auch bei seinen späteren Produktionen noch
dementsprechend vielseitig. Da die Budgets seiner Filme meist sehr niedrig
(selten mehr als 150.000 Dollar, den größten Posten nahmen
dabei oft die Gagen für die Hauptdarsteller ein) und die Zeitvorgaben
dementsprechend knapp angesetzt waren (im Schnitt drei Wochen Drehzeit)
war diese Vielseitigkeit sowie auch die sprichwörtliche Fähigkeit
"aus nichts ein Wunder zu bewirken" für ihn geradezu
lebensnotwendig. In einem Gespräch mit dem Regisseur Luigi Cozzi
erinnerte Bava sich: "Ich habe zwei große Fehler gemacht.
Erstens: Ich kann nicht für länger als zwei Minuten ernst
bleiben. Und für einen Produzenten ist jemand, der keine Brille
trägt und keinen ernsthaft-intellektuellen Gesichtsausdruck hat,
einfach kein guter Regisseur. Zweitens: Ich habe immer versucht, mit
den knappsten Budgets auszukommen. Ich meine, wenn ich für eine
bestimmte Szenen einen Ferrari Dino brauche, geben die Produzenten mir
einen Fiat 500. Ich sollte einen Wutanfall kriegen und alle so lange
anschreien, bis ich endlich kriege, was ich benötige. Doch statt
dessen zucke ich nur mit den Schultern und ändere einfach die Szene
entsprechend, das ist alles. Und das Ergebnis? Anstatt mir zu sagen
'gute Arbeit Mario, dank dir haben wir an unserem Budget gespart, du
weißt wie man mit soclhen Problemen umgeht', weißt du, was
das nächste Mal passiert? Ich verlange einen Fiat 500 und sie geben
mir ein Fahrrad!"
Nach dem Wikingerabenteuer Gli invasori folgte 1962 La ragazza
che sapeva troppo, ein von diversen Filmen Alfred Hitchcocks inspirierter,
schwarzhumoriger Kriminalfilm. La ragazza... war Mario Bavas
letzte Schwarzweiß-Arbeit und gilt zugleich als der erste Vertreter
des Giallo, jener - nach den gelben Einbänden der italienischen
Groschenromane benannten - spezifisch italienischen Form des Thrillers.
1963 entstand I tre volti della paura, ein Episodenfilm nach
Erzählungen von Guy de Maupassant, Alexei Tolstoi und Anton Tschechow.
Vom elegant inszenierten Thriller (Il telefono) über farbenprächtigen
Gothic Horror (Il Wurdalak), bis hin zum raffiniert inszenierten,
unter die Haut gehenden Psychohorror (La goccia d'acqua) führt
I tre volti... perfekt die ganze stilistische Bandbreite von Mario
Bavas Talent vor Augen. I tre volti... kann zu Bavas allerbesten
Filmen gezählt werden und besticht zugleich mit der Präsenz
des Horror-Altmeisters Boris Karloff, der in der Episode Il Wurdalak
den wohl unheimlichsten Auftritt seiner späten Jahre hatte.
Noch im gleichen Jahr folgte La frusta e il corpo, ein gotisches
Horrormelodram, das Christopher Lee und Daliah Lavi als sadomasochistisches
Haß-Liebspaar präsentiert. Ist La frusta... einerseits
allein schon wegen der für die damalige Zeit erstaunlich in Szene
gesetzten Thematik (was dem Film seinerzeit u. a. in den USA diverse
Verstümmelungen einbrachte) eine faszinierende Ausnahmeerscheinung,
so beeindruckt er andererseits mit seinen grandios photographierten
Bildern und der dräuenden gotischen Atmosphäre.
Auch Bavas nächster Film, der 1964 entstandene Thriller Sei
donne per l'assassino war wieder ein Exkurs in die Schattenseiten
der menschlichen Psyche. Im Umfeld eines römischen Haute Couture-Modesalons
treibt ein maskierter Killer sein Unwesen und ermordet nacheinander
sechs Fotomodelle. In elegant durchkompomierten Bildern kreierte Bava
hier eine ultimative Form ästhetisierter "Todeskunst",
wie sie ein rundes Jahrzehnt später auch Dario Argento inspirieren
sollte. Tödlich schön sind die Leichen in dem eleganten Ambiente
arrangiert und blutrote Symbole ersetzen das profane Kunstblut. Die
Figur des maskierten Killers - ein handschuhtragender Anonymus in schwarz
- und der den gesamten Film durchsetzende fetischistische Unterton wurden
zu archetypischen Stilmitteln des Giallo und in zahlreichen anderen
Vertretern des Genres immer wieder zitiert.
Es folgten zwei Ausflüge in Wildwestgefilde: La strada per Fort
Alamo (1964) und Ringo del Nebraska (1965). Anders als bei
vielen seiner italienischen Kollegen blieben Western jedoch eine Ausnahmeerscheinung
in Bavas Oeuvre. Die Materie an sich reizte ihn nicht sonderlich und
obwohl handwerklich solide realisiert, lassen diese Filme deutlich die
unverwechselbare Atmosphäre vermissen, die Bavas restliches Werk
kennzeichnet.
1965 drehte Mario Bava mit Terrore nello spazio seinen einzigen
Science Fiction-Film. Terrore... ist eine raffinierte stilistische
Gratwanderung zwischen Science Fiction und Horror, die mit ihren Spezialeffekten
heute zu den Klassikern des utopischen Films gezählt werden kann.
Mittels einiger - von Sandalenfilmproduktionen übriggebliebener
- Pappmachéfelsen, künstlichen Nebels und gemalter Hintergrundminiaturen
ließ Bava hier eine Planetenlandschaft entstehen, die mehr als
zwei Jahrzehnte später einigen Sequenzen in Ridley Scotts Alien
inspirieren sollte. Terrore... markiert übrigens auch den
Beginn der Zusammenarbeit zwischen Bava und seinem Sohn Lamberto, der
bei diesem Film erstmals als Regieassistent tätig war und in den
folgenden Jahren noch an zahlreichen Projekten seines Vaters mitarbeiten
sollte.
 |
 |
 |
 |
Ein Jahr darauf entstand die Agentenkomödie Le spie vengono
dal semi-freddo, ein ziemlicher Mißerfolg, der heute oftmals
als Bavas schwächster Film bezeichnet wird. Während der Dreharbeiten
starb Bavas Vater und Mentor Eugenio bei einem Verkehrsunfall, ein Verlust
der den Regisseur hart traf und gewiß nicht zum erfolgreichen
Gelingen einer Komödie beitrug. In der Folge löste die amerikanische
Verleihgesellschaft AIP, die Bavas Filme ziemlich erfolgreich in den
USA und anderen englischsprachigen Ländern vermarktet hatte, ihren
Vertrag mit ihm auf. Eigentlicher Anlaß dafür dürfte
weniger der Flop des belanglosen Le spie... gewesen sein, als
vielmehr die Tatsache, daß sich nach Ansicht der AIP Bavas Filme
der letzten Jahre mit ihrer zunehmend negativeren Weltsicht (die "klassischen"
Werte wie Familie, Moral etc. werden permanent in Frage gestellt, oft
genug sterben die "Helden" am Ende) und den unbequemen Subkontexten
der Handlung (sexuelle Obsessionen, Drogenkonsum etc.) immer weniger
für ein Massenpublikum eigneten - geschweige denn für die
Jugendvorstellungen in den USA.
Trotz dieser Niederschläge arbeitete Bava weiter und erschuf noch
im gleichen Jahr das Wikingerdrama I coltelli del vendicatore.
Im Anschluß entstand in nur 12 Tagen Drehzeit der atmosphärische
Horrorthriller Operazione Paura, in dessen Zenrtum der todbringende
Geist eines kleinen Mädchens steht. Operazione Paura ist
ein brillant ausgeleuchtetes Meisterwerk subtiler Horrorfilmkunst und
beeinflußte später sogar Regisseure wie Federico Fellini
(in der von ihm inszenierten Episode Toby Dammit in der Poe-Trilogie
Tre passi nel delirio) und David Lynch (in der letzten Episode
der TV-Serie Twin Peaks).
1967 schließlich folgte Diabolik, die Verfilmung der in
Italien sehr populären Comicserie um den gleichnamigen maskierten
Superverbrecher, die zugleich auch als eine Antwort auf die erfolgreiche
britische James Bond-Serie und André Hunebells von 1964-65
entstandene Fantomas-Trilogie betrachtet werden kann. Der von
Dino DeLaurentiis produzierte Film stellt heute mit seinem phantastischen
Design und seiner temporeichen Erzählweise einen Klassiker des
Sixties-Popart-Kinos dar und bescherte Mario Bava das größte
Budget seiner Karriere, nämlich 3 Mio. $ (von denen er allerdings
gerade einmal 400.000 $ verbrauchte). Der internationale Erfolg von
Diabolik hätte für den Regisseur zu einem Sprungbrett
für eine internationale Karriere werden können, doch ein Angebot
DeLaurentiis' eine Fortsetzung zu drehen lehnte er ab. Bava haßte
den Aufwand an Bürokratie und die Kompromisse, die die Arbeit an
Großproduktionen mit sich brachte. Zugleich verabscheute er auch
die Vorstellung Italien auf längere Zeit verlassen zu müssen,
denn die größten Möglichkeiten im Filmgeschäft
boten sich damals wie heute in den USA. Statt dessen zog er es vor,
weiter im vertrauten heimischen B-Picture-Umfeld zu agieren - eine Entscheidung,
die er später oft bereut hat.
Nachdem er 1968 für die italienische TV-Serie L'odissea
die Episode Polypheme inszeniert hatte, kehrte Bava mit dem sarkastischen
Thriller Il rosso segno della follia ins Gialloterrain zurück.
1969 folgte mit der Westernkomödie Roy Colt e Winchester Jack
sein dritter und letzter Exkurs ins ungeliebte Wildwest-Terrain. Ebenfalls
1969 drehte er Quante volte...quella notte, eine optisch elegant
verpackte, ironische Erotik-Komödie, die drei Variationen ein und
derselben Geschichte um ein verpatztes Rendezvous präsentiert.
Der von Akira Kurosawas Klassiker Rashomon inspirierte Quante
volte... stellt eine absolute Ausnahmeerscheinung in Bavas Oeuvre
dar und wird leider nach wie vor meist sträflich unterbewertet.
Ein Jahr darauf entstand der Thriller Cinque bambole per la luna
d'agosto, ein dramaturgisches Desaster, das jedoch durch Bavas elegante
optische Inszenierung gerettet wird und auch durch die (leider viel
zu kurze) Präsenz der Giallo-Ikone Edwige Fenech und Piero Umilianis
großartigen Soundtrack in Erinnerung bleibt. 1971 schließlich
folgte mit Ecologia del delitto ein weiterer Giallo, der vor
allem mit seinem sardonischen Humor überzeugt und aufgrund einiger
graphisch deutlich realisierter Mordszenen noch Jahre später Horrorregisseure
inspirieren und seltsamerweise zu einem Ruf als Splatterklassiker gelangen
sollte.
1972 wandte Bava sich ein letztes Mal dem Gothic Horror zu und
drehte mit Elke Sommer in der Hauptrolle den ebenso atmosphärischen
wie unterhaltsamen Gli orrori del castello di Norimberga. Produzent
Alfredo Leone war von dem internationalen Erfolg des Films so angetan,
daß er dem Regisseur bei der Auswahl und Realisierung seines nächsten
Projekts Lisa e il diavolo absolut freie Hand ließ. Im
Zentrum dieser kunstvoll inszenierten, romantischen Phantasie um Geisterspuk,
Nekrophilie und den Teufel befand sich abermals Elke Sommer als dämonengejagte
Scream Queen. Weitere Mitwirkende in Lisa... waren u. a. die
Grand Dame des italienischen Kinos Alida Valli und Telly Savalas
als - im wahrsten Sinn des Wortes - teuflischer Butler. Lisa...
wurde Bavas bislang ambitioniertestes und zugleich auch persönlichstes
Werk. Als der Film 1973 bei seiner Uraufführung auf den Filmfestspielen
in Cannes vom Publikum begeistert aufgenommen wurde, fühlte er
sich erstmals in seiner Karriere als Künstler bestätigt.
Auch seine nächste Arbeit ein Jahr darauf - der knochentrockene
Thriller Cani arrabbiati, eine schonungslose Parabel über
das Raubtier Mensch - lag Bava besonders am Herzen. Doch das Projekt
endete in einem Desaster: Kurz vor der endgültigen Fertigstellung
mußte der Produzent Roberto Loyola Konkurs anmelden und der Film
wurde von seinen Gläubigern konfisziert wurde. Cani arrabbiati
gelangte zu Lebzeiten Bavas nie zu einer Kinoaufführung und wurde
erst Mitte der 90er Jahre durch eine Veröffentlichung auf DVD der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Kurz danach folgte ein weiterer Tiefschlag: Ein rundes Jahr nach der
Uraufführung hatte sich immer noch kein Verleih für Lisa
e il diavolo gefunden. Potentiellen Interessenten erschien der Film
schlichtweg zu künstlerisch und abgehoben für das Massenpublikum,
und natürlich war niemand war bereit einen Flop zu riskieren. Um
nun endlich die Produktionskosten ausgleichen zu können, beschloß
Alfredo Leone den Film "publikumsorientiert" umzugestalten.
Lisa... wurde um etliche Szenen gekürzt und um einige neu
gedrehte Sequenzen "bereichert", die den Film nun in einen
The Exorcist-Abklatsch umwandelten. Das Ergebnis kam 1974 schließlich
unter dem Titel La casa dell'esorcismo in die Kinos und hatte
mit dem ursprünglichen Film kaum noch etwas zu tun. Zwar erlebte
Mario Bava den Großteil der Umbearbeitung von Lisa... mit,
hat selbst jedoch nur herzlich wenig dazu beigetragen. Zum Ende der
Neubearbeitung überwarf er sich mit Leone, der die neue Version
schließlich allein fertigstellte.
Verbittert und desillusioniert zog Mario Bava sich in den folgenden
Jahren immer mehr vom Filmgeschäft zurück.
 |
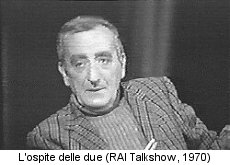 |
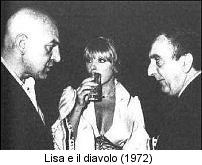 |
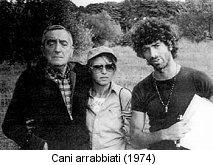 |
Zusammen mit seinem Sohn Lamberto drehte er
1977 noch den Horrorfilm Schock - Transfert Suspence Hypnos.
Bei den Dreharbeiten war Mario Bava selbst jedoch nicht ständig
persönlich anwesend; überwiegend entwarf er nur Storyboards
und überließ weite Teile der eigentlichen Realisierung seinem
Sohn. Lamberto Bava erklärte später, daß sein Vater
oftmals gesundheitliche Gründe vorschob, um nicht am Set zu erscheinen
und ihm so eigene Regieerfahrungen ermöglichen zu können.
Zwar läßt Schock durchaus die visuelle Eleganz von Bavas
früheren Filmen vermissen, kann aber einen sich stetig steigernden
Spannungsaufbau und mit Daria Nicolodi (die damalige Lebensgefährtin
des Regisseurs Dario Argento) eine wirklich exzellente Hauptdarstellerin
aufweisen.
1978 drehte Bava (abermals zusammen mit Sohn Lamberto und abermals mit
Daria Nicolodi in der Hauptrolle) für die Serie Il giorno dei
diavolo der italienischen Fernsehgesellschaft RAI den knapp 60minütigen
Film La venere di Ille, eine gediegen inszenierte Geistergeschichte
nach einer literarischen Vorlage von Prosper Merimeé. La venere...
sollte seine letzte eigene Regiearbeit bleiben.
Durch Daria Nicolodi lernte Bava schließlich auch Dario Argento
kennen und gestaltete 1980 für dessen bildgewaltigen Horrorklassiker
Inferno mehrere Spezialeffekte, so u. a. eine Mondfinsternis
und den furiosen Brand eines Apartmenthauses. Wie Argento Jahre später
erklärte, führte - als er während der Dreharbeiten an
Hepatitis erkrankte - Bava sogar bei einigen Szenen Regie. Um den (zweifelsohne
verdienten) Ruhm seines Fans Argento nicht zu schmälern verzichtete
er darauf, seine Mitwirkung an Inferno namentlich in den Credits
erwähnen zu lassen.
Zuletzt arbeitete er an den Vorbereitungen zu einer Verfilmung des satirischen
Science Fiction-Romans Venus on the Half Shell , den der amerikanische
Autor Philip José Farmer unter dem Pseudonym "Kilgore Trout"
verfaßt hatte; auch hier sollte nach Bavas Wunsch wieder Daria
Nicolodi mitwirken. Doch zu den Dreharbeiten an diesem Projekt sollte
es leider nicht mehr kommen: Am 25. April 1980 starb Mario Bava im Alter
von 65 Jahren an einer Herzattacke.
Drei Tage später starb übrigens Alfred Hitchcock - ebenso
wie dieser hatte Bavas Arbeit enormen Einfluß auf den modernen
Thriller und Horrorfilm, jedoch wird der B-Picture-Magier Bava wohl
nie die allgemeine Akzeptanz und Anerkennung finden, die der Hollywoodregisseur
Hitchcock verdientermaßen hatte. Auch wenn inzwischen moderne
Regisseure wie Dario Argento, Martin Scorcese, Quentin Tarantino, Bill
Condon, Tim Burton und John Carpenter seine Filme als Inspiration nennen,
ist er der breiten Masse nach wie vor unbekannt und wird von "seriösen"
Kritikern immer noch oft genug als "Trivialregisseur" mißachtet.
Nichtsdestotrotz stieg seine Popularität bei Fans von Horrorklassikern
seit den 90er Jahren an, was nicht zuletzt auch den modernen Unterhaltungsmedien
zu verdanken ist, denn inzwischen ist - vor allem in den USA - Bavas
Werk erfreulicherweise fast komplett auf DVD oder VHS erschienen und
somit vor der Vergessenheit gerettet.
"Er verließ die Szene mit der gleichen Diskretion, mit
der er einst seine Arbeit im Filmgeschäft begann", schrieb
Riccardo Freda in seiner Autobiographie. "Er war wirklich einer
der Größten des Kinos ... Für all jene, die von Filmen
mehr Phantasie und eine Flucht aus der Realität statt einer platten
Wiedergabe des gewöhnlichen Lebens erwarten, hinterläßt
Bavas Tod - genau wie der Hitchcocks - eine Lücke, die einfach
nicht gefüllt werden kann."
Bitte beachten Sie das Copyright! Alle Texte auf dieser Website dürfen nur nach ausdrücklicher Genehmigung des Autors abgedruckt oder wiederverwendet werden (dies gilt auch für Veröffentlichungen im Internet)!
Relevante externe Links:
Images
Journal: Mario Bava Biography by Tim Lucas
Italienische
Filmgeschichte: Von den Anfängen bis zum Neorealismus